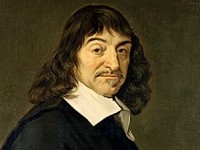
Descartes: Cogito, ergo sum.von Simon Hollendung
|
5. Descartes Trennung zwischen res cogitans und res extensa
Die beiden populärsten Formulierungen des Cogito, gemeint sind die Sätze Cogito, ergo sum und Ego sum, ego existo, verlangen nach einer Wesenbestimmung des ego. Descartes vollzieht diesen Schritt, indem er das denkende Ich als ausschließlich denkende Substanz kennzeichnet, die er res cogitans nennt. Dieses denkende Ding ist strikt vom rein körperlichen Dasein getrennt und kann als solches kein Attribut der Körperlichkeit auf sich beziehen. Es ist somit von allen materiellen Dingen getrennt, die im Körper als res extensa auftreten. Die bloße Materie als res extensa ist somit auch streng getrennt von der denkenden Substanz.[53]
Diese These der zwei voneinander unabhängigen Substanzen fand nicht nur in der Erkenntnistheorie, sondern auch in der Metaphysik Anhänger. Der Dualismus, dem diese Theorie von zwei unabhängigen, nicht auseinander ableitbaren Substanzen zu Grunde liegt wird auch als Zweisubstanzlehre gekennzeichnet und auf die vermeintlichen Gegensatzpaare Geist/Körper sowie Denken/Materie bezogen.
Für die faktische Wirkung der beiden Substanzen aufeinander konstruiert Descartes den Concursus Dei. Die beabsichtigte Bedeutung des lateinischen Wortes Concursus liegt im deutschen Mitwirken, die anderen Bedeutungen wie Zusammenstoss, Auflauf, Aufruhr, das Zusammenlaufen, (zufälliges) Zusammentreffen, (feindlicher) Zusammenstoss oder Ansturm drücken nicht die Tatsache aus, das Gott bei der Wechselwirkung beispielsweise zwischen Leib und Seele im menschlichen Körper, assisitiert.[54]
Der Concursus Dei bewirkt, das von der Konstruktion wesensfremde Grundelemte, die also eigentlich nicht aufeinander wirken können, durch die göttliche Asistenz in Austausch miteinander stehen. Die von Gott vermittelte, übernatürliche Harmonie, die eigentlich unnatürlich ist, wird das zentrale Thema bei den Okkasionalisten und bei Leibniz` "prästabilisierter Harmonie". Für Descartes, den Mathematiker, besteht das Faszinierende vor allem in der Wechselwirkung von Denken und Materie. Letztere fasst er rein mathematisch als (geometrische) Ausdehnung auf.
Die Aussage, "Ich bin ein Ding, das denkt"[55], bedeutet für Descartes mehr als die Zuordnung einer Entität. Die ontologische Interpretation erfährt das Ich als Seele und rückt so in den Mittelpunkt der cartesianischen Philosophie. In den griechischen Wörtern psyche und pneuma und in den lateinischen Übersetzungen animus und spiritus liegt die ganze Bandbreite dieses Begriffes. Descartes geht auf diese Vielfältigkeit nicht ein. Er macht das Ich als Seele zum Ding, was ihm viel Kritik eintrug. Diese Verdinglichung lässt sich nach Ansicht vieler Autoren nicht bei Descartes entkräften.[56] Der Vorwurf bleibt bestehen und lässt sich nur dadurch erläutern, dass er die Erklärung für das Verhältnis von Seele und Körper suchte, wobei die Definition des ego nicht im Mittelpunkt stand.
Per analytischer Methode, wie im methodischen Zweifel erprobt, zeigt Descartes, dass es über die Materie des menschlichen Körpers keine gesicherten Urteile geben kann. Da ich aber beweisbar existiere, kann meine Existenz nicht vom körperlichen, unbeweisbaren abhängen. Aus dem unsicheren Wissen meiner Stofflichkeit kann kein gesichertes Wissen über mein Selbstsein entstehen. Dieser Übergang endet für Descartes in der Feststellung, dass der Geist nicht vom Körper abhängen kann: "Außer dem Geist erkenne ich nämlich noch nichts an mir. [...] Ich weiß jetzt, dass die Körper nicht eigentlich von den Sinnen oder von der Einbildungskraft, sondern von dem Verstand allein wahrgenommen werden, und zwar nicht, weil wir sie berühren und sehen, sondern lediglich, weil wir sie denken; und so erkenne ich, dass ich nichts leichter oder evidenter wahrnehmen kann als meinen Geist."[57]
Für Wolfgang Röd ergibt sich aus der methodischen Folgerung, dass der Geist vom Körper verschieden ist die Frage, ob dies auch real so sei. Dazu musste Descartes seiner Meinung nach erst beweisen, dass alles, was sich per theoretischer Methode als verschieden denken lässt, in Wirklichkeit auch verschieden ist. Analytisch gewonnene Erkenntnisse müssen quasi mit der Wirklichkeit verglichen werden. Wichtig ist in diesem Fall die Annahme objektiver Wahrheiten als von Gott gegeben. Diese objektiven Wahrheiten können aber nur von einem objektiv wahren Gott geliefert werden und nicht durch den Betrügergott des extremen Zweifels. Deshalb steht der Gottesbeweis, als Feststellung der realen Existenz eines wahrhaftigen Gottes, auch am Beginn der Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa.[58] Die "entscheidende Stelle, wo sich Descartes von der ursprünglich [...] umfassenden Bedeutung der Cogitatio abwendet und im Hinblick auf den tierischen Leib zum Mechanismus, im Hinblick auf die menschliche Seele zum Rationalismus und durch seine dogmatische Feststellung des Unterschieds von Leib und Seele zum Dualismus gelangt"[59], befindet sich im Discours.
[54] Menge: Langenscheidts Taschenwörterbuch. Lateinisch. S. 118.
[55] Rene Descartes, Meditationes de Prima Philosophia. Schmidt, Gerhart (Hrsg. und Übers.). S. 99.
[56] Röd, Wolfgang: Rene Descartes. S. 78.
[57] Rene Descartes, Meditationes de Prima Philosophia. Schmidt, Gerhart (Hrsg. und Übers.). S. 96f.
[58] Vgl. für ganzen Abschnitt: Röd, Wolfgang: Rene Descartes. S. 78.
[59] Rene Descartes: Discours de la methode. S. 43f. Den oben angegebenen Hinweis gibt der Hrsg. in der
Fußnote auf seite 44.
Inhalt
- Descartes: Cogito, ergo sum
- 1.1 Der Weg zum methodischen Zweifel
- Die Radikalisierung des methodischen Zweifels
- 1.3 Was ist klare und distinktive Wahrheit?
- 2.1 Die Grenzen des Zweifels in Descartes Epoche
- 2.2 Die Scholastik
- 2.3 Descartes und die Autoritäten
- 2.4 Neue Wissenschaft oder neue Scholastik?
- 3. Von der Radikalisierung des methodischen Zweifels zum Cogito, ergo sum
- 4.1 Die verschiedenen Formulierungen des Cogito
- 4.2 Die Vorläufer des Cogito, ergo sum
- 4.3 Kein enthymematischer Syllogismus
- 4.4 Die Besonderheiten des Cogito
- 4.5 Das "Ich" im Cogito
- 4.6 Das "ergo" im Cogito-Argument
- 4.7 Der Seinsbegriff im Cogito-Argument
- 4.8 Der temporale Aspekt des Cogito, ergo sum
- 5. Descartes Trennung zwischen res cogitans und res extensa
- 6. Das angeborene Wissen
- 7. Das Cogito ergo sum und die heutige Theologie
- Zu guter Letzt
- Literaturverzeichnis
- Links